
Die Bezeichnung der Gegenwart als Anthropozän, einer Epoche also, in welcher der Mensch und sein Handeln als ein geologischer und ökologischer Faktor – wenn nicht sogar der entscheidende – betrachtet werden muss, ist längst nicht mehr alleiniger Gegenstand der Naturwissenschaften. Im historischen Lernen verschränken sich Vergangenheit und Gegenwart zusammen mit der Zukunft als Zeitdimensionen in der Fähigkeit zur Orientierung in der Zeit. Daher ist notwendig, den Zusammenhang zwischen Zeitbewusstsein und historischem Denken zu erforschen, insofern das Verstehen des Anthropozäns sowohl das Verstehen langer Zeiträume voraussetzt als auch das Bewegen innerhalb verschiedener disziplinärer Wissensfelder, die diese Zeiträume definieren. Folgende Veröffentlichungen von meinen Partner:innen und mir liegen bereits vor oder erscheinen in Kürze:
[Hrsg. mit Andreas Sommer] Das Anthropozän (Themenheft), Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 23 (2024), (September 2024)
[mit Sebastian Barsch] „Geschichtsbewusstsein und „Zeitbewusstheit“: Geschichtsdidaktische Überlegungen zum Begriff der Zeit im Anthropozän“, in: Geschichtsbewusstsein, Geschichtsbilder, Zukunft, hrsg. v. Jörg van Norden und Lale Yildirim (Geschichtsdidaktik theoretisch, 3). Schwalbach: Wochenschau, 2024. (September 2024)
[mit Sebastian Barsch und Martin Nitsche] „Zeitkonzepte in gesellschaftswissenschaftlichen Lehrplänen: eine deutsch-schweizerische explorative Studie“, Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften (2023). 45–62 (peer reviewed)
[mit Sebastian Barsch und Martin Nitsche] „Diffundierende Zeit – das Anthropozän als Herausforderung für das historische Zeitverstehen“, Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 22 (2023): S. 85–100. (peer reviewed)
[mit Sebastian Barsch] „Concepts of Time in Science Education and History Didactics: Towards an Interdisciplinary Approach to Environmental History“, in: Why History Education, hrsg. v. Peter Gautschi, Markus Furrer and Nadine Fink. Schwalbach: Wochenschau, 2023. S. 311–322 (peer reviewed)
„‚Anregung zum Müßiggang‘: Geschichtsdidaktik und Zeitgeschichte in Zeiten von Katechismus-Debatte, Globalisierung und Anthropozän“, in: Geschichtsdidaktische Perspektiven auf die Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, hrsg. v. Sebastian Barsch (Think! Historically: Teaching History and the Dialogue of Disciplines, 3). Kiel: Universitätsverlag Kiel, 2022. S. 61–68. Open Acess https://doi.org/10.38072/2703-0784/p33
„‚Schwellenwerte‘: Das Anthropozän erfahren“, in: Historische Erfahrung, hrsg. v. Jörg van Norden und Lale Yildirim (Geschichtsdidaktik theoretisch, 1). Frankfurt: Wochenschau, 2022. S. 265–278. (reviewed)
„Climate(s) of Change: Towards a ‘Radical’ Concept of History Education in the Anthropocene?“, Geschichtstheorie am Werk, 13.12.2022: https://gtw.hypotheses.org/9976 (Zugriff 13.12.2022). Frz. Übersetzung: „Climat(s) de changement : Vers un concept « radical » de l’enseignement de l’histoire dans l’Anthropocène ?“, übers. v. Bettina Severin-Barboutie, Geschichtstheorie am Werk, 10.01.2023: https://gtw.hypotheses.org/10320 (Zugriff 16.01.2023).
[mit Alexander Denzin] „‚Gesellschaftliche Naturaneignung‘: Skizzen über das ZusammenDenken von Sozial- und Umweltgeschichte in der Geschichtsdidaktik“, Kaleidoskop Kenkmann, 04.11.2022: https://kaleidoskop.hypotheses.org/852 (Zugriff: 04.11.2022).
[Abbildungsnachweis: Los Angeles glowing outside the window <https://www.flickr.com/photos/52614599@N00/162363485> (12.12.2022) by Doc Searls <https://www.flickr.com/photos/docsearls/> (12.12.2022), used and licensed under CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/?ref=openverse> (12.12.2022), not modified.
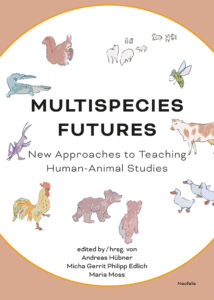
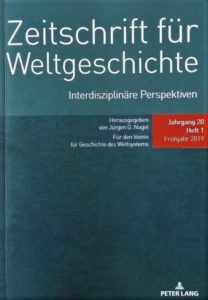
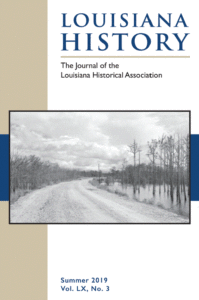
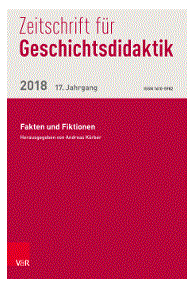
 In seiner Herbstausgabe berichtet der „
In seiner Herbstausgabe berichtet der „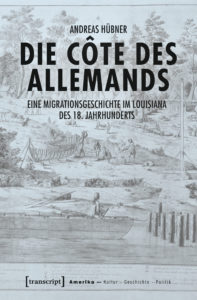
 Im Frühjahr 2017 bin ich für mehrere Tagungen und Diskussionsforen in die Vereinigten Staaten aufgebrochen, um die vorläufigen Ergebnisse meines aktuellen Forschungsprojektes vorzustellen und mit einschlägigen HistorikerInnen zu debattieren. Zur Erinnerung: Derzeit untersuche ich die Erfahrungen der deutschamerikanischen Gemeinschaft von New Orleans während des Ersten Weltkrieges. In Shreveport, Louisiana, hielt ich hierzu im Rahmen der Jahrestagung der
Im Frühjahr 2017 bin ich für mehrere Tagungen und Diskussionsforen in die Vereinigten Staaten aufgebrochen, um die vorläufigen Ergebnisse meines aktuellen Forschungsprojektes vorzustellen und mit einschlägigen HistorikerInnen zu debattieren. Zur Erinnerung: Derzeit untersuche ich die Erfahrungen der deutschamerikanischen Gemeinschaft von New Orleans während des Ersten Weltkrieges. In Shreveport, Louisiana, hielt ich hierzu im Rahmen der Jahrestagung der